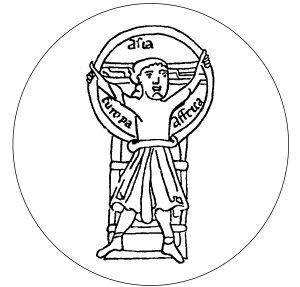Newsletter für Mitglieder: Einreichungen bis 06.09.2024
Der Newsletter des Mediävistenverbandes wird zukünftig etwas erweitert werden: Um die interdisziplinäre Vernetzung aktiv zu fördern und mehr Partizipation zu ermöglichen, können nun auch Sie als Mitglieder verbandsrelevante Informationen wie fachübergreifende Veranstaltungen, Ausschreibungen oder Calls for Papers für die quartalsweise erscheinenden Rundschreiben einreichen. Die redaktionelle Betreuung übernimmt Bianca Waldmann. Einsendungen für die kommende Herbst-Ausgabe richten […]